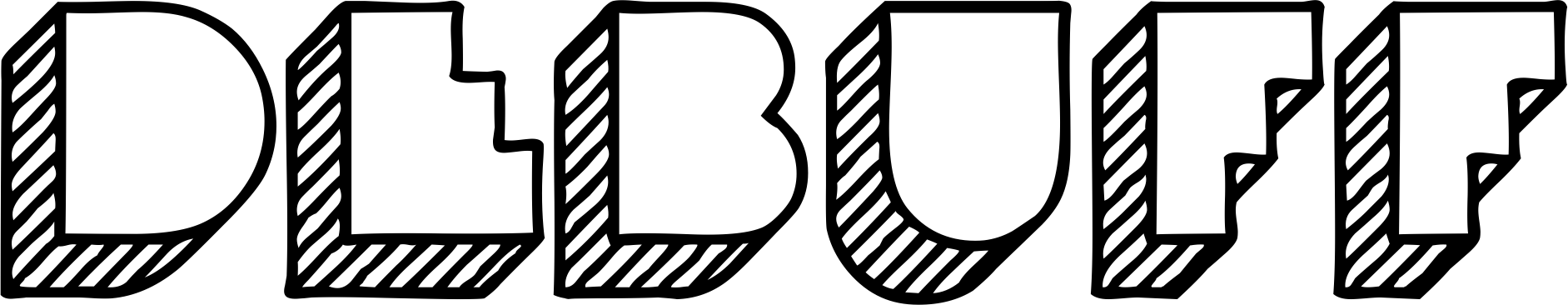Dass die Spieleindustrie ohne Mobile Games besonders aus ökonomischer Sicht ärmer wäre, zeigen Spiele wie Genshin Impact. Laut AppMagic generierte das Free-To-Play-Rollenspiel allein 2023 weltweite Einnahmen von einer Milliarde US-Dollar. Kern des Spiels ist seine gacha-Mechanik, bei der Ingame-Währung eingesetzt wird, um zufällige Gegenstände und Charaktere aus einem virtuellen Lostopf zu ziehen.
Dabei wurde gacha nicht in Videospielen erfunden, obwohl das Medium es heute auch in westlichen Ländern bekannt gemacht hat. Die ursprünglichen Gachapon-Kapselmaschinen aus Japan existieren seit 1965. "Gachapon-Großvater" Ryuzo Shigeta importierte damals einen Münzautomaten aus den Vereinigten Staaten und modifizierte die Preise, indem er sie in Plastikkapseln legte.
Genau diese Plastikkapsel gibt Gachapon ihren Namen: gacha oder gasha bezieht sich auf das Geräusch beim Kurbeln der Maschine und pon auf das Fallen der Kapsel in die Auffangschale. Der lautmalerische Ausdruck in einem Wort macht Gashapon zu einem sogenannten Onomatopoetikum, also Wörter, die akustische Eindrücke wiedergeben und typisch für die japanische Sprache sind.
Woher kommen Gachapon-Maschinen?
"Gachapon-Maschinen hat man ursprünglich an zwei Orten gefunden: In Supermärkten oder in Shoppingzentren", erklärt Bryan Hikari Hartzheim. Hartzheim ist Professor an der Waseda-Universität in Tokio und hat sich auf die Geschichte und Kultur neuer Medien in Japan spezialisiert. "In Shoppingzentren waren sie oft auf dem obersten Stockwerk zu finden. Da gab es zum Beispiel Spielplätze, wo die Eltern ihre Kinder lassen konnten, während sie einkaufen waren. Dann gab es noch dagashiya, Läden, die sehr günstige Süßigkeiten verkauft haben, und häufig Gachapon vor ihren Geschäften hatten, um vor allem Kinder anzulocken."
Obwohl dagashiya mittlerweile aus der Mode geraten sind, sind sie auch heute noch ein nostalgisches Symbol für Japans Showa-Ära (1926 bis 1989), die sich durch einen ökonomischen Boom und Japans Rolle als Weltmacht nach dem Zweiten Weltkrieg auszeichnet. Im Einkaufs- und Unterhaltungsdistrikt Odaiba in Tokio gibt es zum Beispiel die Daiba-1-Chome-Einkaufsstraße. Diese ist im Stil der Showa-Ära gehalten und bietet dutzende dagashiya-Läden, aber auch Retro-Kulissen wie Telefonzellen und Zugmodellen zum Fotos machen. Das Konzept der Gachapon-Maschinen stammt aus genau dieser Zeit, auch wenn sich die Inhalte geändert haben.