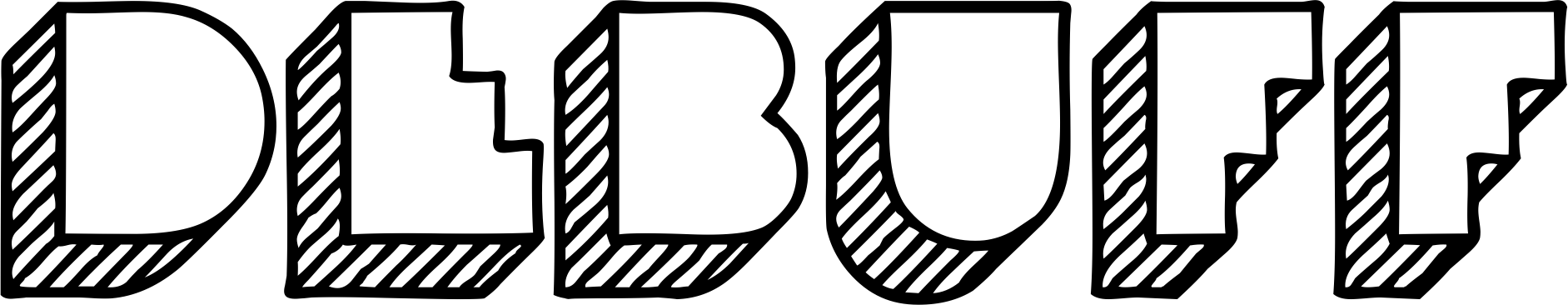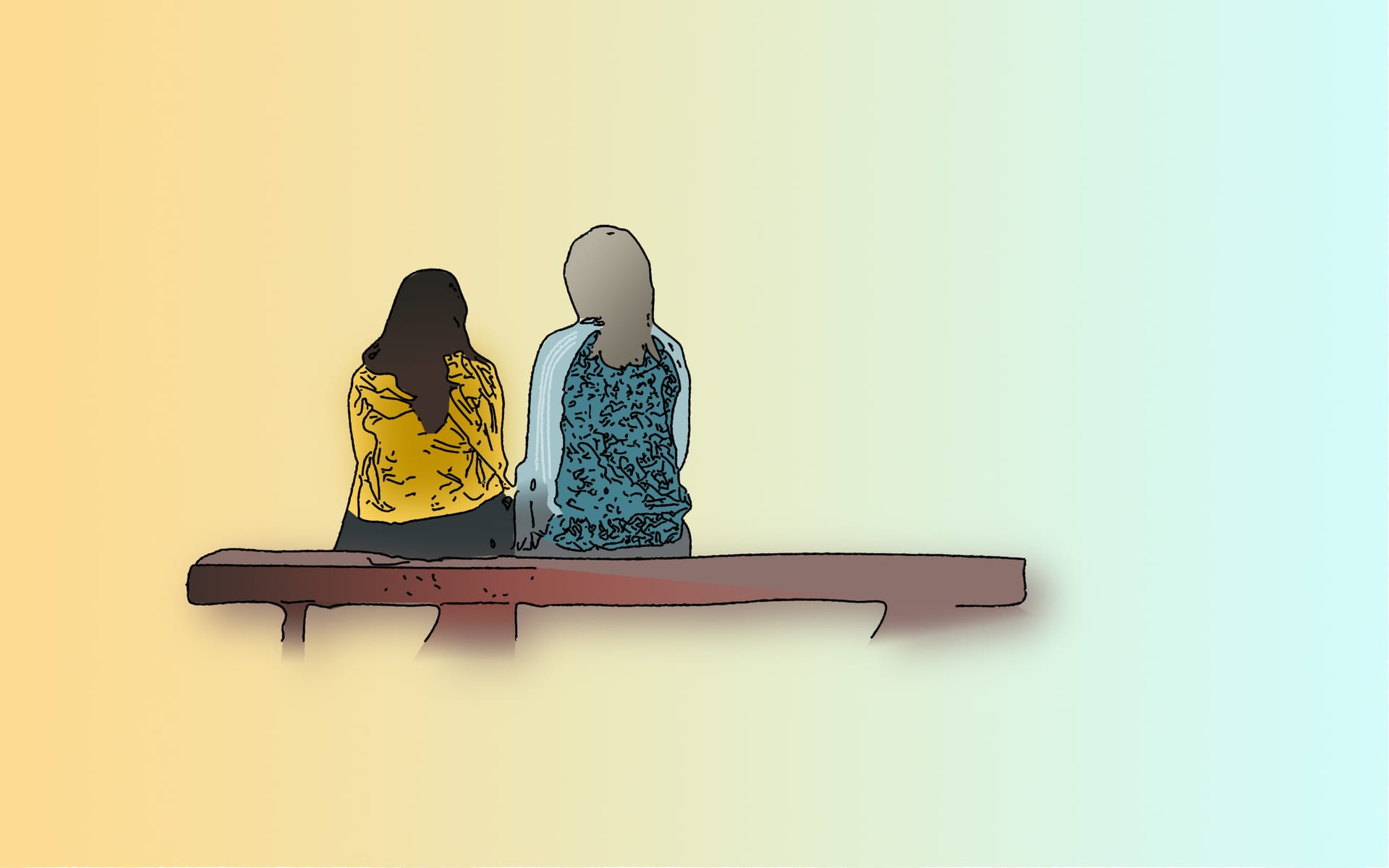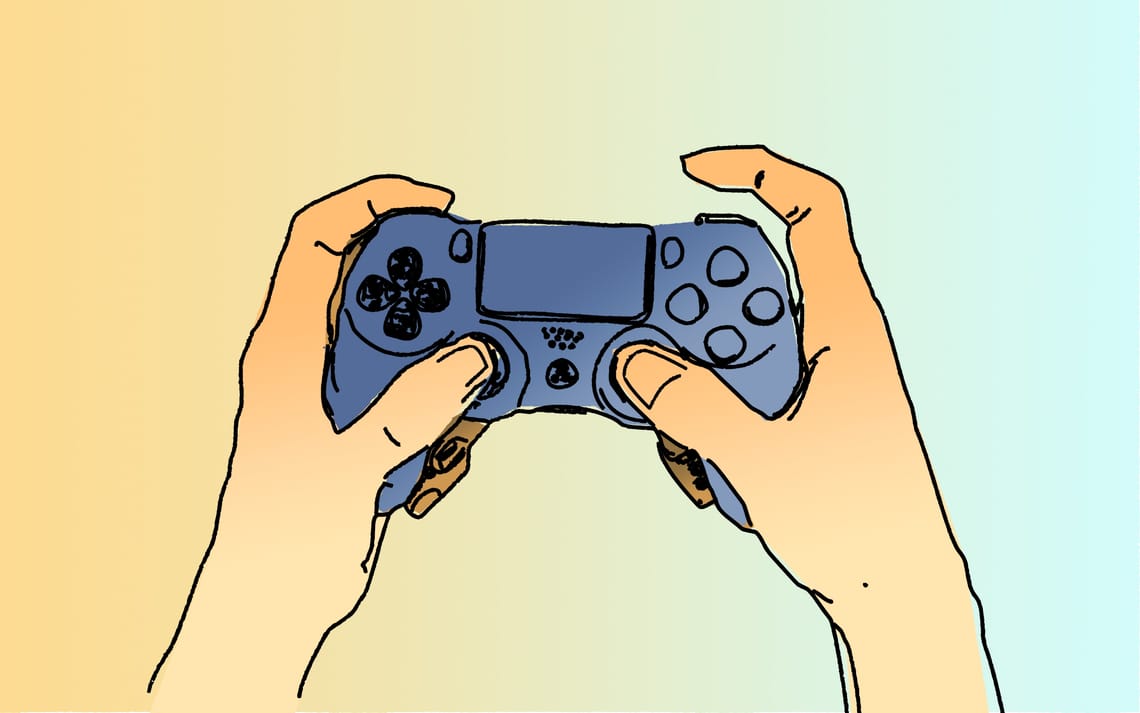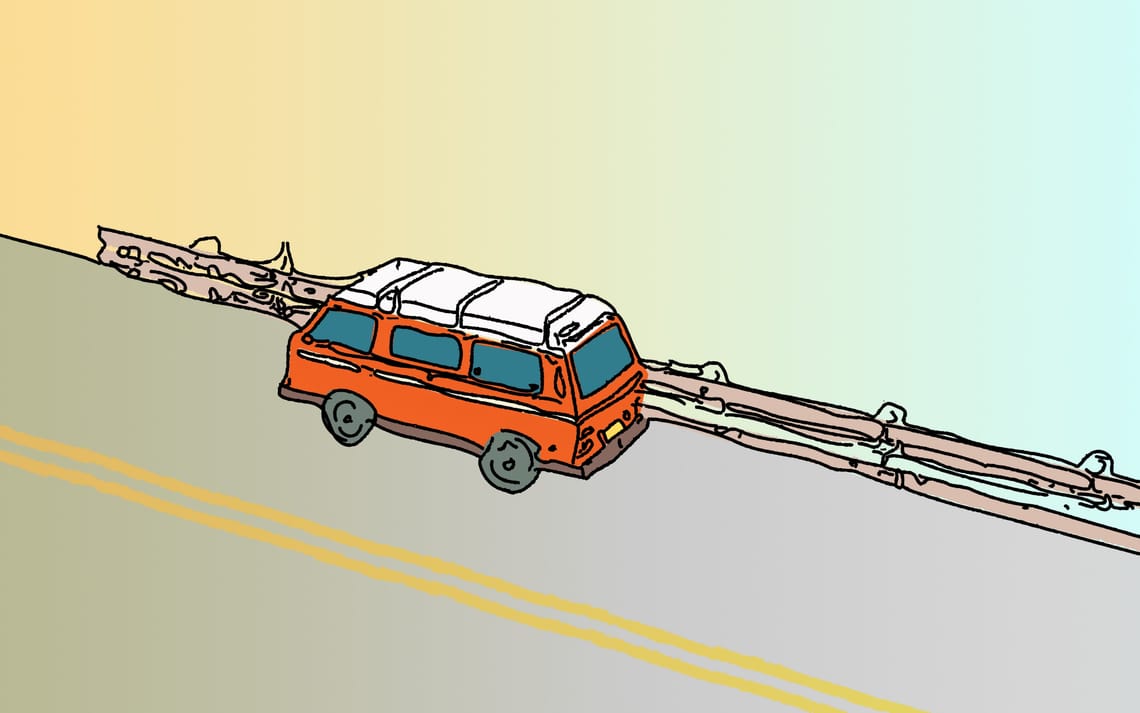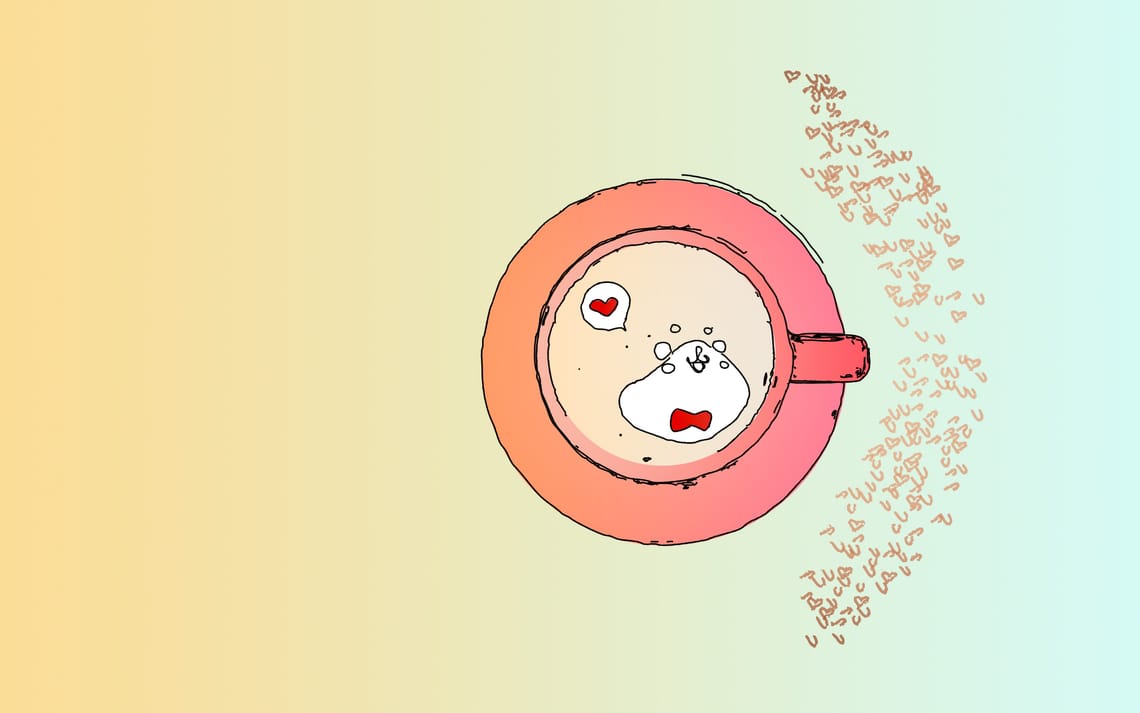In der Nazi-Folterkammer müssen wir die unmögliche, unmenschliche Wahl treffen: Welchen unserer Widerstandsgefährten retten wir – Fergus oder Wyatt? Entscheide dich für einen. Dem anderen werden bei lebendigem Leib die Augen ausgerissen. Auch im Star-Wars-Universum werden die ganz großen Fragen gestellt: Sith oder Jedi? Begeben wir uns auf den Pfad des Lichts oder der Dunkelheit? Und in der Unterwasser-Dystopie BioShock fragt uns das Spiel: Retten wir die Little Sisters oder ernten wir lieber Ressourcen aus ihnen? Spiele wie Wolfenstein: The New Order, Knights of the Old Republic oder BioShock stellen uns vor moralische Entscheidungen. Die sind oft gelobt, manchmal auch als oberflächlich kritisiert worden.
Moral = epische Superlative?
Abgesehen von ihrer Qualität: Es sind solche Entscheidungen, die immer wieder bemüht werden, wenn die Rede von Moral in Spielen ist. Spiele wie die Telltales The Walking Dead oder The Wolf Among Us bringen uns in moralische Zwickmühlen, bei denen wir uns zwischen Optionen entscheiden müssen, von denen keine optimal ist. Moral in Spielen heißt oft: Eine möglichst brutale Entscheidungssituation, in der es um Leben und Tod geht, die idealerweise langfristige Konsequenzen im Spiel hat. Das Problem dabei: Unsere Vorstellung davon, was moralisch wertvoll oder auch nur interessant an und in Spielen ist, ist stark von diesen Superlativ-Dilemmata geprägt.
Aber: Spiele stellen nicht nur dann wichtige moralische Fragen, wenn sie die Spielenden vor Schwarz-oder-Weiß-, Gut-oder-Böse-, Ganz-oder-gar-nicht-Entscheidungen stellen. Der Fokus auf diese epischen Superlative, die immer noch oft einhergehen mit überlebensgroßen Storys (unter Weltrettung machen es ja viele Spiele nach wie vor nicht) verhindert, dass wir erkennen, wie viel Hands-on-Moral in Spielen eigentlich steckt. Die Moral, wie wir sie tagtäglich leben, viel besser widerspiegelt und dabei gesellschaftliches Transformationspotenzial hat.